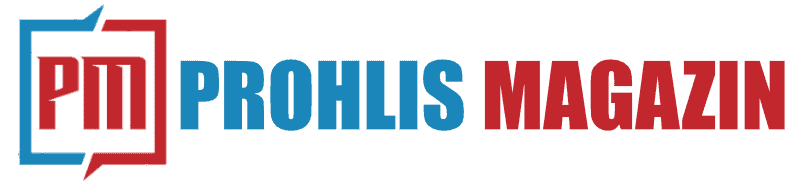Inhaltsübersicht
Entstehung im Kontext des DDR-Wohnungsbaus
Die Prohliser Allee entstand Mitte der 1970er Jahre als zentrale Magistrale des neuen Großwohnsiedlungsgebietes Dresden-Prohlis. Nachdem 1973 ein umfassendes Wohnungsbauprogramm in der DDR verkündet worden war, wählte man Prohlis, das damals noch ein ländlich geprägter Dresdner Stadtrand war, als Standort für eines der ersten Neubaugebiete Dresdens. Am 26. Februar 1976 wurde feierlich der Grundstein gelegt und bereits im Oktober 1976 konnten die ersten Mieter ihre modernen Wohnungen beziehen. Innerhalb kurzer Zeit entstanden zwischen 1976 und 1980 rund 10.000 neue Wohnungen in Plattenbauweise für etwa 30.000 Menschen. Prohlis avancierte damit – neben Gorbitz – zu einer der größten Plattenbausiedlungen Dresdens.
Die Planung von Prohlis erfolgte nach dem Idealbild der „sozialistischen Stadt“. Das Neubaugebiet entstand buchstäblich „auf der grünen Wiese“ – auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dafür mussten der alte Dorfkern und sogar das historische Prohliser Schloss abgerissen werden. Die Lage bot günstige Voraussetzungen: flaches Terrain mit wenigen Bauhindernissen, nahegelegene Industriearbeitsplätze im Dresdner Südosten und eine vergleichsweise kurze Anbindung an das Stadtzentrum. SED-Bezirkschef Hans Modrow formulierte 1976 den Anspruch, in Prohlis ein zukunftsfähiges Wohngebiet zu schaffen, in dem „effektives Bauen, Funktionstüchtigkeit und Schönheit“ vereint würden.
Vorgesehen war nichts Geringeres als eine „perfekte sozialistische Stadt“ mit überwiegend autofreien Bereichen, viel Grün und Sonne für jede Wohnung sowie kurzen Wegen zu Kindergärten und Schulen. In diesem Sinne plante man eine großzügige zentrale Achse: In Nord-Süd-Richtung sollte eine fast einen Kilometer lange Flaniermeile entstehen – eine begrünte Promenade entlang der Prohliser Allee mit zahlreichen Geschäften, Schaufenstern und Dienstleistungseinrichtungen in einstöckigen Ladenzeilen. Diese Ladenstraße sollte am zentralen Platz (dem damaligen Otto-Grotewohl-Platz, heute Jacob-Winter-Platz) in ein Stadtteilzentrum mit Kaufhaus, Kulturhaus und weiteren Läden münden.
Bauliche und infrastrukturelle Entwicklung seit den 1970er Jahren
Das ehrgeizige städtebauliche Konzept konnte in der DDR nur teilweise umgesetzt werden. Die Wohnblöcke sind schnell in die Höhe geschossen, aber die Infrastruktur hat da nicht mitgezogen. Viele Erstbewohner mussten ihre Wege anfangs über provisorische Pfade durch den Schlamm finden. Die neuen Wohnungen waren mit allem Komfort, den man sich wünschen kann, ausgestattet. Bad mit Wanne, Innen-WC, Fernwärme. In Prohlis wohnte es sich also ganz gut, aber die öffentlichen Anlagen und Versorgungseinrichtungen waren leider nicht so toll. Das „Herzstück“, die Prohliser Allee als grüne Flaniermeile, war zunächst nur eine Idee.
Das Stadtteilzentrum am Otto-Grotewohl-Platz wurde nur rudimentär verwirklicht: Anstelle eines großen Warenhauses eröffnete lediglich eine einfache Kaufhalle (Supermarkt) der Handelsorganisation. Entlang der langen Wohngebäude gab es anfangs nicht so viele Läden und Dienstleister, wie man sie geplant hatte. Bis 1989 gab es im Wohngebiet neben fünf Lebensmittelläden nur drei gastronomische Einrichtungen: die Gaststätte „Zum Stern“ von 1977, das „Café Spree“ von 1978 und die Eisdiele „Espresso“ von 1981.
Es gab kein Kulturhaus oder Kino, und wer kulturelle Angebote suchte, musste ins Stadtzentrum fahren. Immerhin wurde 1981 die lang ersehnte ÖPNV-Anbindung fertiggestellt. Und zwar mit der Straßenbahn (Linien 13 und 17 der Dresdner Verkehrsbetriebe). Die Straßenbahn fährt auf zwei Gleisen in der Mitte der Prohliser Allee und verbindet das Viertel direkt mit dem Dresdner Zentrum bis zur Endhaltestelle an der Dohnaer Straße.
In den späten 80ern wurde das Viertel noch erweitert: 1987 wurde dann das „Magnet“-Kaufhaus neben der bestehenden Kaufhalle eröffnet. Das größere Einkaufszentrum sollte die Nahversorgung verbessern. In der Nähe wurde 1988 auch ein neues Hallenbad gebaut. Zusammen mit dem Freibad, das es schon früher gab, ist es ein Kombibad.

Trotzdem war Prohlis bei der Wende 1990 immer noch ein typisches Plattenbaugebiet mit Defiziten in der Ausstattung. Nach der politischen Wende ging es dann mit der Infrastruktur voran: Supermärkte, Dienstleister und kleine Geschäfte aus dem Westen zogen ein, und das Magnet-Gebäude wurde zum echten Stadtteilzentrum umgebaut. Heute findest du in diesem Einkaufszentrum am Jacob-Winter-Platz (in der Mitte von der Prohliser Allee) verschiedene Läden (z. B. Supermarkt, Drogerie), Dienstleister und sogar ein Bürgerbüro der Stadt Dresden. Die Verkehrserschließung wurde weiter verbessert, während zugleich durch verkehrsberuhigende Maßnahmen viele Wohnwege autofrei gehalten wurden, wie es dem ursprünglichen Konzept entsprach.
Architektonische und städtebauliche Merkmale entlang der Straße

Die Prohliser Allee wurde in den 1970er Jahren mit typischen Plattenbauten bebaut. Die Wohnblöcke vom Typ WBS 70 wurden in serieller Bauweise errichtet und sind meist 6 oder 10 Geschosse hoch, manchmal auch bis zu 17 Geschosse. Die Wohnungen sind locker angeordnet, durch Grünflächen voneinander getrennt und so positioniert, dass alle Wohnungen maximalen Tageslichteinfall erhalten. Das ist ein Ergebnis der DDR-Planungsvorschrift zur „Besonnung“.
Es fällt auf, dass fast alle Wohnungen zweiseitig ausgerichtet sind. Eine Seite zeigt zur Erschließungsstraße (bzw. zur Tramhaltestelle), die andere zu ruhigen, grünen Hofbereichen. Entlang der Prohliser Allee selbst gibt es breite Fußwege und begrünte Streifen. Schon bei den Erdgeschossen der Wohnblöcke waren Gemeinschaftseinrichtungen oder Läden eingeplant. Das sieht man heute noch an den langen Fensterfronten und ehemaligen Ladenräumen. Viele dieser Flächen wurden nach 1990 neu genutzt (z. B. als Beratungsstellen, Vereinsräume oder kleinere Geschäfte).
Die Prohliser Allee hat ein paar echt auffällige Elemente, zum Beispiel die großen Grünflächen mit besonderen Kunstinstallationen. In den 2000ern wurde der zentrale Abschnitt der Straße – zwischen dem nördlichen Albert-Wolf-Platz und dem Jacob-Winter-Platz – aufgewertet und neu gestaltet. Dabei hat man zehn riesige Fußabdrücke in den Rasen gemacht, deren Sohlen als bepflanzte Beete genutzt werden. Die „Zehen“ dieser Fußabdrücke sind durch fünf unterschiedlich große Findlingssteine angedeutet. Jeder dieser grünen Fußabdrücke ist ungefähr 18×9 Meter groß und macht die Allee zu etwas ganz Besonderem. Die Gestaltung ist einzigartig und symbolisiert die Schritte in die Zukunft des Stadtteils. Gleichzeitig dient sie der Aufenthaltsqualität. Am Albert-Wolf-Platz steht auch ein Brunnen mit Pusteblumen-Elementen. Die Teile stammen von einem alten Brunnen aus der Prager Straße, der 2009 hierher versetzt wurde. Auch Kunst am Bau aus der Entstehungszeit ist (oder war) entlang der Allee zu sehen. So zierte ein großes Keramikmosaik die Fassade eines Hochhauses an der Ecke Herzberger Straße 30 / Prohliser Allee. Das Mosaik heißt „Landschaft“ und wurde 1976 von Klaus Dennhardt gemacht. Das Wandbild gibt’s heute nicht mehr, es wurde wohl bei einer Sanierung entfernt.
Die Hauptplätze an beiden Enden der Prohliser Allee sind echte Hingucker. Im Süden geht die Straße in die Dohnaer Straße über (in der Nähe vom Dohnaer Platz). Da ist auch die Endhaltestelle der Straßenbahn, und das ist ein wichtiger Knotenpunkt. Im Norden liegt der Albert-Wolf-Platz, der als öffentlicher Raum und Eingangstor nach Prohlis dient. In der Mitte des Platzes findest du Grünflächen und Gehwege, die von hohen Wohngebäuden umgeben sind. In der Mitte der Prohliser Allee findest du den Jacob-Winter-Platz, das Zentrum des Stadtteils. Dort findest du öffentliche Einrichtungen und Geschäfte: das Prohlis-Zentrum (ein Einkaufszentrum, das früher Magnet-Kaufhaus war) mit seinen Läden und Dienstleistungen, das Ortsamt/Bürgerbüro und kulturelle Angebote. In der Nähe steht auch der Palitzschhof, ein altes Gutshaus, das als einziges Gebäude des alten Dorfes Prohlis erhalten blieb. Heute ist es das Palitzsch-Museum zur Stadtteilgeschichte. Die Prohliser Allee und ihre Umgebung haben ein echt besonderes Stadtbild, das aus historischer Substanz, sozialistischer Moderne und nachwendischer Nachrüstung besteht.
Soziokulturelle und wirtschaftliche Aspekte
Die Prohliser Allee hat im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Entwicklungen durchgemacht, sowohl sozial als auch kulturell. In der DDR-Zeit war das neue Wohngebiet Prohlis erst mal der Hit und ziemlich prestigeträchtig – moderne Wohnungen mit Zentralheizung und Warmwasser lockten sogar prominente Dresdner (z. B. den Schlagersänger Olaf Berger oder Fußballer von Dynamo Dresden) hierher. Das Viertel bestand damals hauptsächlich aus jungen Familien und berufstätigen Neubürgern, die stolz auf ihren Plattenbau waren. Es gab Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kinderkrippen, Kaufhallen und ein paar Gaststätten. Die wurden oft genutzt und haben das nachbarschaftliche Leben gefördert. Es gab auch erste kulturelle Initiativen, zum Beispiel die „Galerie Süd“, eine kleine Kunstgalerie im Viertel, oder Jugendklubs für die vielen Jugendlichen. Trotzdem gab es nicht so viele Freizeitmöglichkeiten, und viele mussten für Kino, Theater oder größere Einkäufe ins Stadtzentrum fahren. Prohlis hatte selbst kaum Arbeitsplätze, außer im Einzelhandel. Die meisten Bewohner pendelten zu den Industriebetrieben in anderen Teilen Dresdens oder ins Umland.
Nach 1990 hat sich die soziale Struktur deutlich geändert. Viele der ursprünglichen Bewohner sind in attraktivere Wohnlagen gezogen, als nun auch die Altbauwohnungen in der Stadt saniert wurden und es andere Wohnangebote gab. Die Plattenbauwohnungen in Prohlis wurden in den 1990ern teils an sozial schwächere Leute und Spätaussiedler vergeben, teils standen sie längere Zeit leer. Der Stadtteil hatte den Ruf einer sozial benachteiligten Plattensiedlung mit hohen Arbeitslosenzahlen und Einkommensproblemen. In der Prohliser Allee und drumrum sieht man das zum Beispiel an den leeren Läden und dem ganzen Grau. Die lokale Wirtschaft beschränkte sich vor allem auf das Einkaufszentrum am Jacob-Winter-Platz, einige Discounter, Dienstleister wie Sparkasse und Post und kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Nähe gibt’s keine Industrie oder größere Gewerbebetriebe, aber am Stadtrand liegen ein paar Einkaufszentren, zum Beispiel der Kaufpark Nickern, und Gewerbegebiete. Da gibt’s auch Arbeits- und Versorgungsmöglichkeiten.
Nach 1990 hat sich die soziale Struktur deutlich geändert. Viele der ursprünglichen Bewohner sind in attraktivere Wohnlagen gezogen, als nun auch die Altbauwohnungen in der Stadt saniert wurden und es andere Wohnangebote gab. Die Plattenbauwohnungen in Prohlis wurden in den 1990ern teils an sozial schwächere Leute und Spätaussiedler vergeben, teils standen sie längere Zeit leer.
Der Stadtteil hatte den Ruf einer sozial benachteiligten Plattensiedlung mit hohen Arbeitslosenzahlen und Einkommensproblemen. In der Prohliser Allee und drumrum sieht man das zum Beispiel an den leeren Läden und dem ganzen Grau. Die lokale Wirtschaft beschränkte sich vor allem auf das Einkaufszentrum am Jacob-Winter-Platz, einige Discounter, Dienstleister wie Sparkasse und Post und kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Nähe gibt’s keine Industrie oder größere Gewerbebetriebe, aber am Stadtrand liegen ein paar Einkaufszentren, zum Beispiel der Kaufpark Nickern, und Gewerbegebiete. Da gibt’s auch Arbeits- und Versorgungsmöglichkeiten.
Aktuelle Entwicklungen und Planungen
In letzter Zeit legt Dresden den Fokus verstärkt auf die Aufwertung von Prohlis und insbesondere der Prohliser Allee. Im September 2023 hat der Stadtrat dann auch den „Masterplan Prohlis 2030+“ beschlossen. In diesem Entwicklungsplan stehen ungefähr 100 Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass die Lebensqualität im Stadtteil besser wird. Darunter sind sowohl Investitionen in die Infrastruktur als auch soziale Projekte. Ein zentrales Ziel ist es, die soziale Mischung der Bewohner zu erhöhen und den Zusammenhalt im Viertel zu stärken. Es ist zum Beispiel geplant, Bildungs- und Freizeitangebote für Jugendliche zu machen, die Teilhabe aller Altersgruppen zu fördern und die öffentlichen Räume aufzuwerten.
Die Prohliser Allee und ihre Plätze sind in diesen Planungen echt wichtig, weil sie die Hauptachse des Viertels bilden. Ein wichtiger Punkt im Masterplan ist die Neugestaltung des nördlichen Albert-Wolf-Platzes. 2024 haben wir in einem Werkstattverfahren mit mehreren Architekturbüros einen Plan für diesen Platz gemacht. Jetzt wollen wir den endlich umsetzen. Der Albert-Wolf-Platz soll deutlich aufgewertet werden. Die Aufenthaltsqualität soll besser werden, es soll mehr Sicherheit geben und neue Begegnungsmöglichkeiten für die Anwohner. Es wird auch über die Errichtung eines kommunalen Gesundheits- und Beratungszentrums am Platz gesprochen, um die medizinische und soziale Versorgung vor Ort zu bündeln. Außerdem wollen wir Grünflächen und Beleuchtung verbessern, damit die Allee insgesamt freundlicher und sicherer wirkt.

An der Prohliser Allee sind außerdem noch weitere Projekte geplant. Es wird also immer wieder in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Erst 2023 wurden die Gleise an der Straßenbahntrasse erneuert und die Fahrbahnen am Albert-Wolf-Platz saniert. So wollen wir den öffentlichen Nahverkehr und die Erschließung optimieren. Fuß- und Radwege sollen nach und nach barrierefrei und ansprechend gestaltet werden. Dazu gehören auch neue Beleuchtung und Sitzgelegenheiten.
Die Wohnungsunternehmen haben vor, in den kommenden Jahren weitere Gebäudesanierungen entlang der Straße durchzuführen. Damit soll der energetische Standard gehoben und die Wohnqualität erhöht werden. Es wird auch viel Wert auf die Gestaltung der Außenbereiche gelegt. Nach dem Erfolg der Fußabdrücke sind weitere kreative Elemente denkbar. Außerdem sollen bestehende Grünanlagen gepflegt und wo nötig erneuert werden. Aber klar, die Umsetzung hängt auch von den finanziellen Rahmenbedingungen ab.
Anfang 2025 kam raus, dass Dresden für ein paar wichtige Projekte aus dem Masterplan 2030 nicht genug Geld hat.